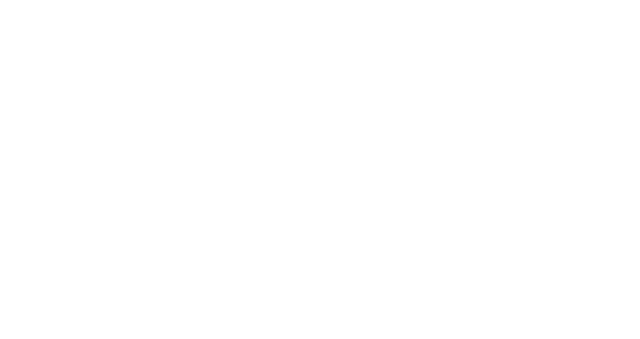Seit 1985 Ihre Rechtsanwälte für Arbeitsrecht, Beamtendienstrecht, Liegenschaftsrecht und Agrarrecht in Innsbruck
Die Kanzlei wurde im Jahr 1985 von Dr. Josef Klaunzer als Allgemeinpraxis in Innsbruck gegründet. Im Laufe der Jahre konnten wir mit den Eintritten von Partnern wie Dr. Alfons Klaunzer, Dr. Johannes Klausner, Dr. Peter Klaunzer und Mag. Martin Flatscher die Fachgebiete und Tätigkeitsfelder unserer Kanzlei sukzessive erweitern.
Spezialisiert haben wir uns auf die folgenden Fachbereiche:
- Arbeitsrecht
-
- Im Arbeitsrecht helfen wir insbesondere bei der Erstellung von Arbeitsverträgen und in arbeitsrechtlichen Fragen.
- Beamtendienstrecht
-
- Das Beamtendienstrecht umfasst die gesamte Beratung und Vertretung von Beamten und Dienstgebern.
- Liegenschaftsrecht
-
- Im Liegenschaftsrecht unterstützen wir bei der Abfassung von Verträgen aller Art und deren grundbücherliche Durchführung.
- Agrarrecht
-
- Im Agrarrecht beraten wir unsere Mandanten beim Kauf und Verkauf von landwirtschaftlich genutzten Liegenschaften.
Weitere Fachgebiete
Arbeits- und Sozialrecht
Beamtendienst- und Disziplinarrecht
Handelsvertreterrecht
Datenschutzrecht
Agrarrecht, Forstrecht
Grundverkehrs- und Höferecht
Bäuerliches Übergabsrecht
Erbrecht und Verlassenschaftsabhandlungen
Baurecht und Raumordnung
Bauträgervertragsrecht
Liegenschaftsverträge samt Grundbuchsabwicklung
Mietrecht
Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht
Verkehrsrecht, Unfallschäden, Verwaltungsstrafsachen